Programm

Vortragsprogramm
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuellste Produktentwicklungen aus der Industrie finden in unseren Vorträgen der Scientific Conference und des Forum for Innovation ihren verdienten Platz.

Posterausstellung
Ein besonderer Teil des SEPAWA CONGRESS sind die wissenschaftlichen und anwendungstechnisch orientierten Poster-Ausstellungen in den Kategorien Home Care, Personal Care, Fragrance, Fundamental Research, Packaging und Sustainability.

After Event
Genießen Sie die fantastische Küche unserer Spitzenköche und eine Topunterhaltung bei unserem beliebten After Event.

Get Together
Ein lockeres Beisammensein mit alten Bekannten und neuen Kontakten beim Get-Together des SEPAWA CONGRESS in Berlin.
Vortragsprogramm

European Detergents Conference
20 Jahre EDC – Die Zukunft der Waschmittelchemie

Cosmetic Science Conference
Cosmetic Science: “Reliable Cosmetics for the Future”

SEPAWA Conference
Auch dieses Jahr haben wir zusammen mit den Fachgruppen interessante und viele neue Themen ausgewählt.
Blättern Sie durch das Programm und lassen sich dabei inspirieren.
Posterausstellungen
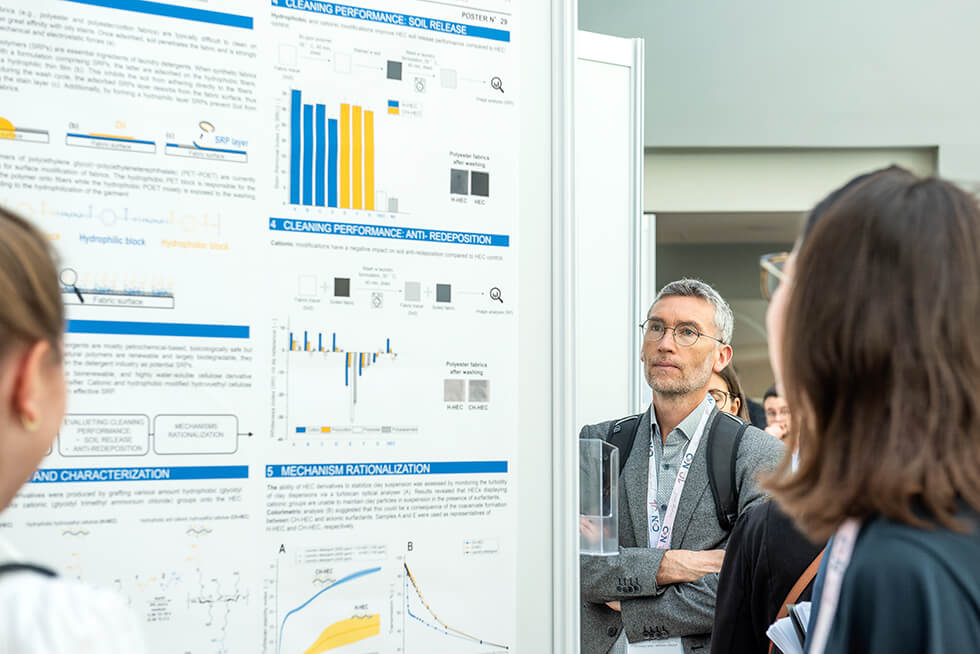
Posterausstellung
Finden Sie hier Poster zu den Konferenzen:
- Scientific Conference
- European Detergents Conference
- Forum for Innovation

Poster Tours & Awards
Treffen Sie die Poster Presenter für mehr Informationen und besuchen Sie die Poster Award Session der EDC.
Weitere Events

Ausstellung
Im Ausstellungsbereich präsentieren mehr als 300 Firmen die neuesten Produkte, Trends und vielfältiges Know-How.

Jahreshauptversammlung
Für persönliche, korporative oder Fördermitglieder des SEPAWA e.V.

Absolvententreffen TKW
Für Absolventinnen und Absolventen sowie Studierende der „Technologie der Kosmetika und Waschmittel“
